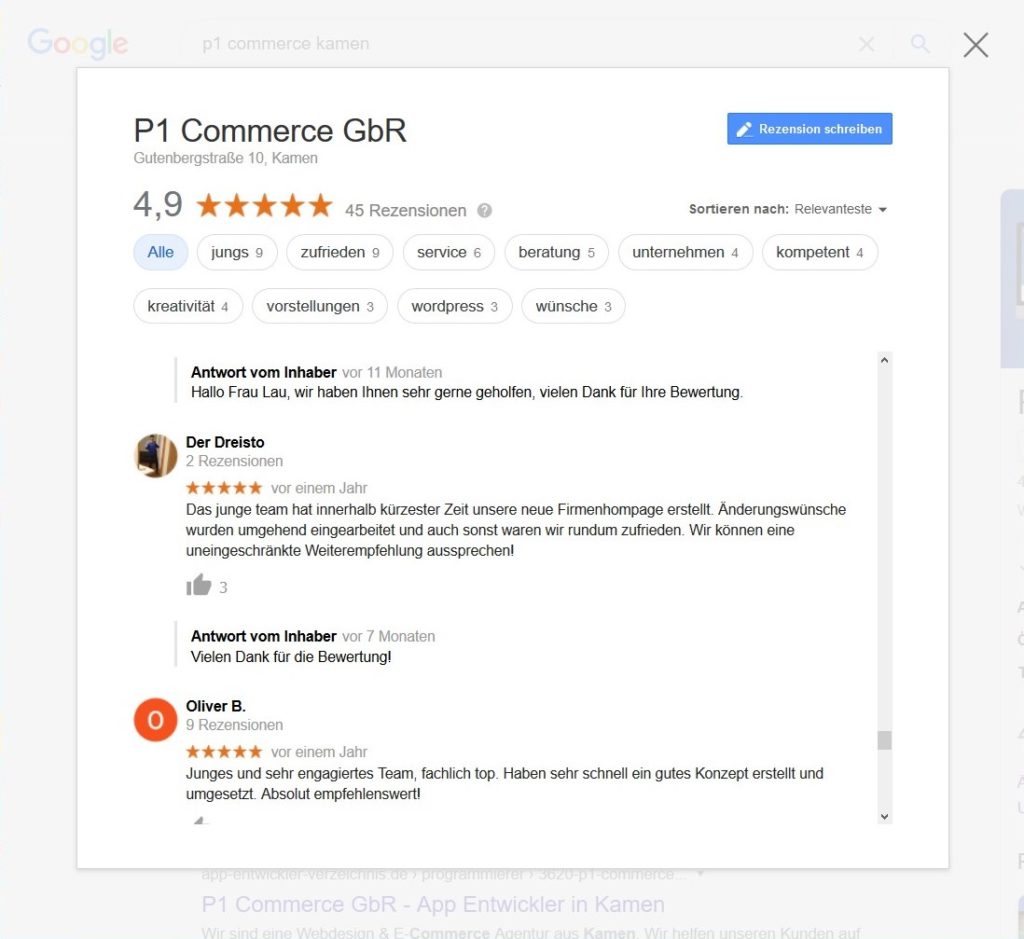Das Oberlandesgericht Dresden hat am 22.Juli 2020 durch einen prozessleitenden Beschluss (Akz. 4 U 652/20) seine Rechtsauffassung in der Sache dargelegt und dem Kläger die Rücknahme seiner Berufung nahegelegt, weil sie keine Aussicht auf Erfolg habe. Der Kläger habe die Online-Rezension, deren Unterlassung er beantragte, nicht konkret beanstandet.
Wer einen Betreiber wegen einer auf dessen Plattform veröffentlichten Online-Rezension als sogenannten Störer auf Unterlassung (Löschung / Sperrung) in Anspruch nimmt, muss erläutern, warum er die Rezension beanstandet. Das OLG zitiert das Jameda II-Urteil des Bundesgerichtshofs: „Ist der Provider mit der Beanstandung eines Betroffenen konfrontiert, die so konkret gefasst ist, dass der Rechtsverstoß auf der Grundlage der Behauptung des Betroffenen unschwer bejaht werden kann, ist eine Ermittlung und Bewertung des gesamten Sachverhalts unter Berücksichtigung einer etwaigen Stellungnahme des für den beanstandeten Beitrag Verantwortlichen erforderlich.“
Die Beanstandung müsse beschreiben, durch welchen Teil der veröffentlichten Behauptungen welches Recht des oder der Bewerteten aus welchem Grund verletzt ist. „Der unspezifische Hinweis auf eine angebliche Einschränkung bzw. Diffamierung von Persönlichkeitsrechten der Mitarbeiter des Klägers lässt“ nach Ansicht des OLG „nicht erkennen, welche der Behauptungen des Nutzers der Kläger aus welchem Grund beanstanden will.“
Soweit der Kläger bestreitet, überhaupt geschäftlichen Kontakt zum Rezensenten gehabt zu haben, solle nach Auffassung des Gerichts ein Hinweis des Klägers, dass der Rezensent in den Geschäftsbüchern des Klägers nicht geführt werde, als konkrete Beanstandung dann nicht ausreichen, wenn der „Geschäftsbetrieb des Klägers in erheblichem Ausmaß auf Laufkundschaft setzt.“ Denn dann habe auch die Möglichkeit bestanden, dass ein Kunde ohne Voranmeldung die Dienste im Geschäft des Klägers in Anspruch nimmt.
Ebenso wenig reiche die Behauptung, er – der Kläger – könne zum Besuch des Rezensenten „keine Angaben“ machen. Dieser Behauptung lasse sich nicht entnehmen, der Kläger wolle zum Ausdruck bringen, der Rezensent sei niemals Kunde im Geschäft des Klägers gewesen.
Die beklagte Plattformbetreiberin sei auch nicht verpflichtet, die – nach Löschung des Bewertungstextes – isolierte Ein-Stern-Bewertung zu löschen. Eine Bewertung durch Vergabe von Sternchen ist unbestritten eine Meinungsäußerung. Diese sei bis zur Grenze der Schmähkritik vom Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt. Dies gelte selbst dann, wenn „die zu ihrer Begründung angeführten Tatsachenbehauptungen unwahr sind.“
Die beklagte Plattformbetreiberin habe auch ihrer sogenannten sekundären Darlegungslast genügt, mit der Folge, dass der Kläger vollen Beweis für seine Behauptung erbringen müsse, der Rezensent habe in keinem geschäftlichen Kontakt zu ihm gestanden.
Ein beliebter Einwand von Geschäftsleuten, die online schlecht bewertet wurden, ist, der Rezensent habe keinen geschäftlichen Kontakt zu ihnen gehabt. Mit dieser Behauptung können die Bewerteten auch oft durchdringen, denn wer in keinem Kontakt zum Bewerteten stand, hat kein „berechtigtes Interesse“, eine Bewertung veröffentlichen zu lassen. Erteilt z.B. der Rezensent seine Bewertung – was er gesetzlich darf, § 13 Abs.6 TMG – unter einem Pseudonym, ist es dem Bewerteten in vielen Fällen nicht möglich festzustellen, ob ein Geschäftskontakt bestanden hat. Der Bewertete kann dann in der Sache nichts erwidern; er weiß nicht, welchen Sachverhalt der Rezensent bewertet. Er kann auch nicht ausschließen, dass der Rezensent niemals Kontakt zu ihm hatte und eine sogenannte Fake-Bewertung veröffentlichen ließ. Der Bewertete gerät also in Beweisnot.
Hierfür hat die Rechtsprechung die Rechtsfigur der sekundären Darlegungslast etabliert und die Rechtsposition für eine auf diese Weise in Beweisnot geratene Partei verbessert. Der Bundesgerichtshof drückt es in seiner Jameda II-Entscheidung, in der es um eine Ärztebewertung ging, so aus: „Die sekundäre Darlegungslast umfasst zunächst diejenigen für einen solchen Behandlungskontakt sprechenden Angaben, die der Beklagten, insbesondere ohne Verstoß gegen § 12 Abs. 1 TMG, möglich und zumutbar sind. Die Beklagte hat im Streitfall jedoch eine darüber hinausgehende Recherchepflicht. Dem Bestreitenden obliegt es im Rahmen seiner sekundären Darlegungslast, Nachforschungen zu unternehmen, wenn ihm dies zumutbar ist. Im Streitfall folgt die Zumutbarkeit einer Recherche schon daraus, dass die Beklagte aufgrund ihrer materiellen Prüfpflicht ohnehin gehalten ist, vom Bewertenden zusätzliche Angaben und Belege zum angeblichen Behandlungskontakt zu fordern. Dem entspricht in prozessualer Hinsicht ihre Obliegenheit, im Rahmen ihrer sekundären Darlegungslast vom Bewertenden entsprechende Informationen zu fordern. Kommt die Beklagte dieser Obliegenheit nicht nach, ist die Behauptung des Klägers, der von ihm angegriffenen Bewertung liege kein Behandlungskontakt zugrunde, nach den allgemeinen Regeln über die sekundäre Darlegungslast … als zugestanden zu bewerten“.
In dem vom OLG zu bewertenden Fall war der Sachverhalt eher untypisch: Der Kläger hatte vor Klage unter Einschaltung eines Mediators versucht, die näheren Umstände der Bewertung aufzuklären. In diesem Zusammenhang hatte der Rezensent bereits „zahlreiche Einzelheiten“ des bewerteten Besuchs preisgegeben. Das Gericht hielt es wegen der „detaillierten Schilderung“ des Kundenkontakts für plausibel, „dass es sich bei dem Nutzer M…… entweder um einen „Laufkunden“ ohne Reservierung gehandelt hat oder die Bewertung unter Pseudonym abgegeben wurde, was ohne weiteres zulässig ist und im Verhältnis zwischen Hostprovider und betroffenem Dritten auch nicht zu einer erweiterten sekundären Darlegungslast führt.“ Dem stehe auch nicht entgegen, dass der Rezensent (Nutzer) keinen Kassenzettel oder sonstigen Beleg mehr vorlegen konnte.
Die beklagte Plattformbetreiberin habe ihrer sekundären Darlegungslast in Bezug auf den bestrittenen Kundenkontakt daher genügt. Den Beweis dafür, der Rezensent sei nicht sein Kunde gewesen, habe daher weiterhin der Kläger zu tragen. Den Beweis habe er allerdings nicht erbracht.
Ihrer mit der sekundären Beweislast des Plattformbetreibers korrespondierenden Prüfpflicht (oben, 2. Absatz) habe die Beklagte ebenfalls genügt. Sie habe nach der Beanstandung durch den Kläger den Rezensenten, dem sie die Beanstandung des Klägers übermittelte, aufgefordert, „den der Bewertung zugrunde liegenden Sachverhalt möglichst umfassend und unter Vorlage von Belegen darzustellen“. Die hierauf vom Nutzer übersandte Stellungnahme habe die Beklagte wiederum unverzüglich an den Kläger weitergeleitet. „Mehr kann im Rahmen des notice-and-take-down Verfahrens von ihr aber nicht verlangt werden.“
Internetrecht | Online-Rezensionen
§§ 823 Abs. 1, 824, 1004 Abs. 1 S. 2 BGB analog, Art. 2 Abs. 1, Art. 1 GG